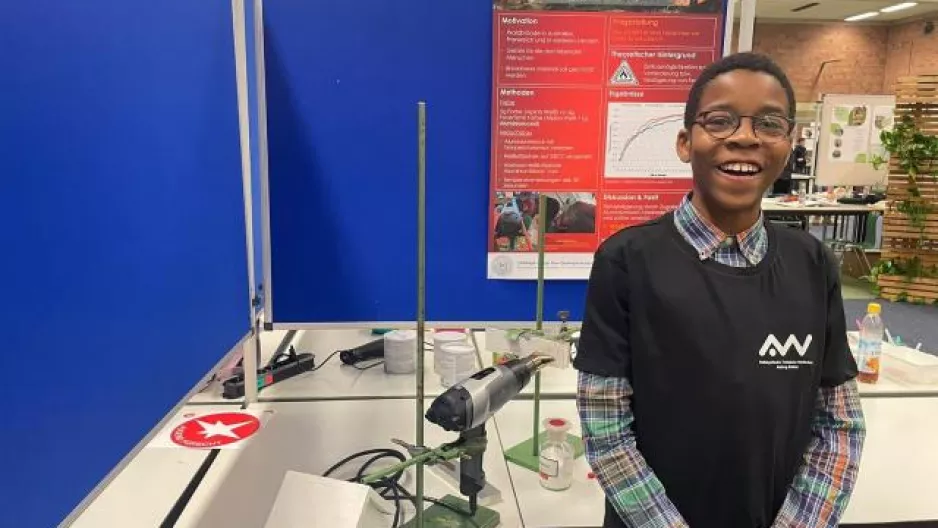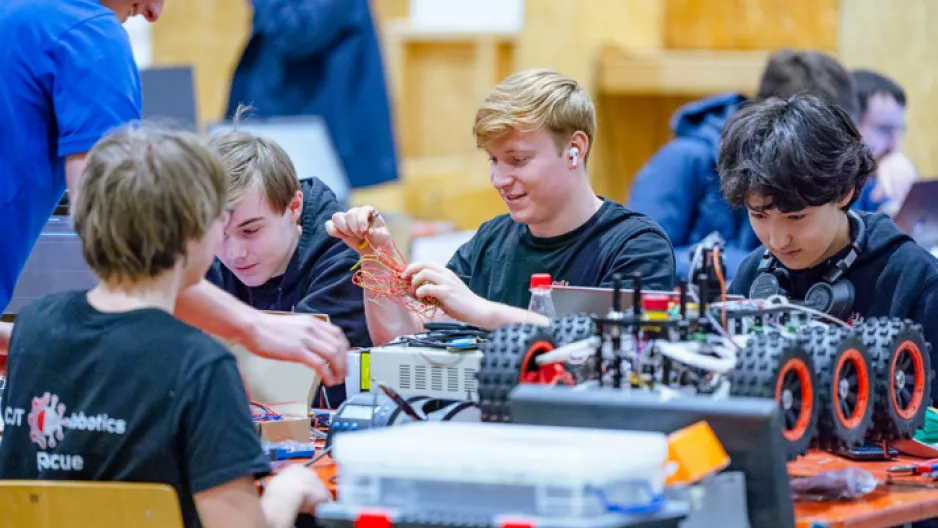Während die Physik die Zeit als relativ ansieht, scheint sie im Labor doch eher unflexibel und gnadenlos. Diese Erfahrung machten auch die Biologie-Leistungskurse der Q12G9, als wir uns einer Herausforderung ungeahnten Ausmaßes stellten: das Lösen eines Kriminalfalls.
Zu diesem Zwecke wurde uns von der TU München ein DNA-Analyse Set mit passender Entführungsakte zur Verfügung gestellt. Mit modernster Technik sowie einer Reihe von Reagenzien sollten wir die zu unserem Opfer passende Spur ausfindig machen. Die Aufgabe schien simpel: Vervielfacht die zwei DNA-Proben, die an den zwei möglichen Tatorten gefunden wurden und findet heraus, welche davon mit der des Entführungsopfers übereinstimmt.
Um das Genmaterial so zu vervielfachen, dass die Menge für Analysen tauglich ist, muss die DNA-Probe mithilfe der in der Forschung und Kriminalistik unabdingbaren PCR-Technik vervielfältigt werden. Bei dem Vorgehen werden Enzyme zur Replikation von DNA, sowie die nötigen Einzelbausteine zusammen mit der Probe in eine Art Brutkasten gegeben. Dieser reguliert die Temperatur des Gemisches, so dass das Enzym ungehindert arbeiten kann. Aufgrund kleiner technischer Probleme erwies sich dieser Schritt als äußerst langwierig, und sprengte im Alleingang schon unseren Zeitplan, obwohl er nur ungefähr die Hälfte der tatsächlichen Arbeit ausmachte.
Der zweite Arbeitsschritt bestand aus der Vorbereitung der Gelelektrophorese. Hier wird ein Gel hergestellt, das die vervielfältigen DNA-Proben mithilfe eines elektrischen Feldes unterschiedlich weit wandern lässt. Wenn nun die DNA-Proben in das Gel gegeben werden, kann die DNA verschiedener Menschen in einem einzigartigen Muster aufgetrennt werden. Nach gespanntem Warten zeigten sich die charakteristischen Streifen und unser Täter konnte entlarvt werden. Fazit: Begeht keine Verbrechen, sonst müssen LaborantInnen Überstunden schieben.
Marius Ernstberger